Article
ESPI on site: Der Panni Pfuffer

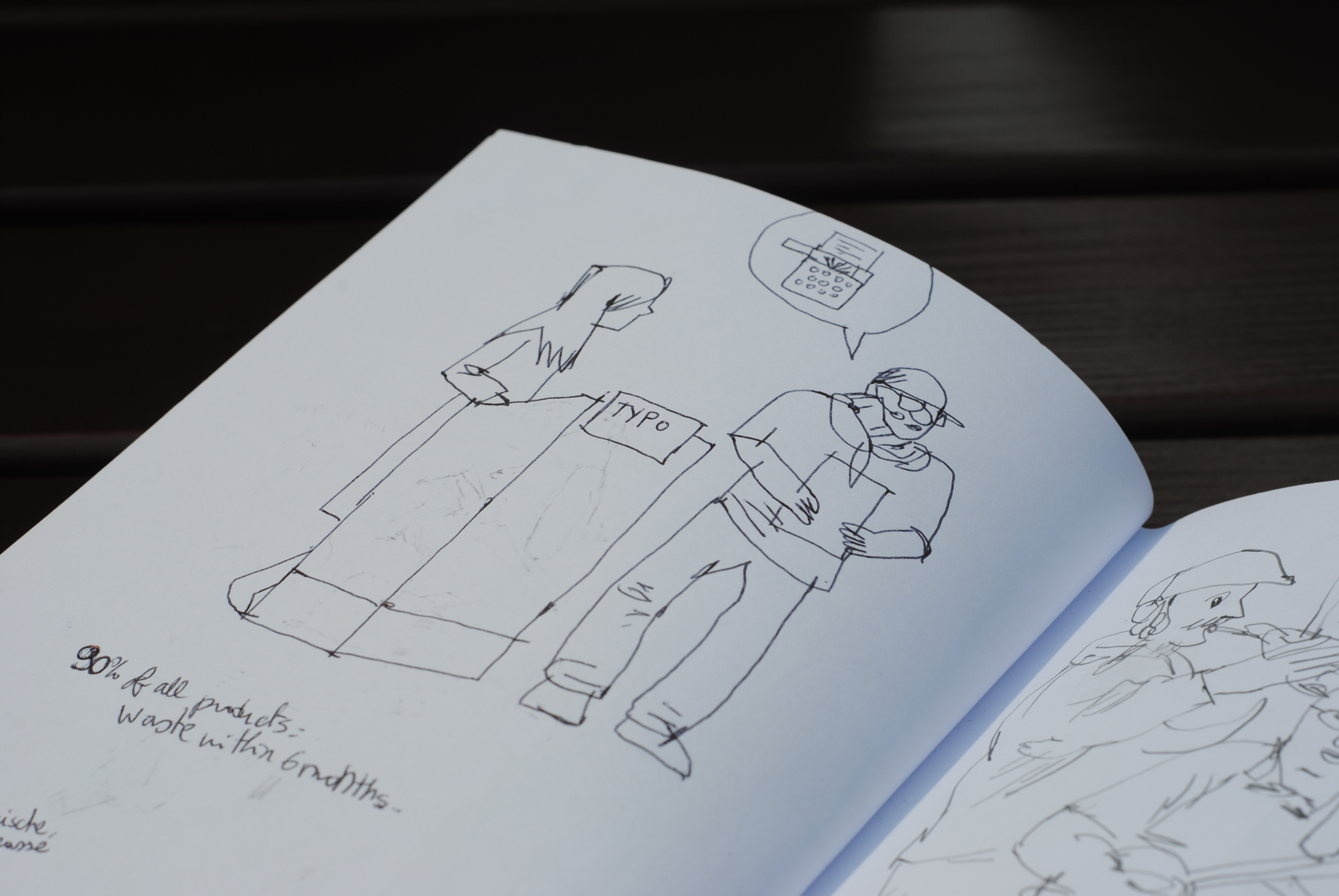
(Illustration: Sylvain Mazas)
Michael Schirner steigt 1968 nicht auf die Barrikaden, sondern ein in die Werbung – und bald so hoch auf wie kaum jemand. Mit radikalen Ideen verändert er die Auffassungen von Kommunikation. Mit seinen Arbeiten postuliert er die Überwindung der Grenze zwischen freier und angewandter Kunst – und wird durch legendäre Kampagnen zur Ikone der Werbegeschichte in Deutschland.
Werbung ist pfui
Moment. Ikone der Werbegeschichte? Überhaupt: Werbung?! Werbung ist doch pfui (allein schon als Vokabel). Heute jedenfalls. Damals, in Düsseldorf (und Hamburg, und München), war Werbung hip und hoch anspruchsvoll. Die Abgrenzung von Werbung pfui und Design hui gab es in dieser Form noch nicht (zumindest nicht in Erinnerung der Autorin) – oder lange nicht so strikt wie heute.
[readmore]Weiterlesen[/readmore]
Michael Schirner ist sich treu geblieben: Das Leben ist Werbung, Werbung ist Kunst, so die zusammenfassende Einleitung für ihn auf der TYPO Berlin. Richtig. Richtig zumindest für ihn. Er studierte bei Max Bill, Max Bense und Bazon Brock an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg. Heute ist er Professor der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe und Honorarprofessor der Hochschule für Künste Bremen, außerdem an der Kyushu University Fukuoka in Japan (Faculty of Design) und der Central Academy of Fine Arts in Peking.
Auf der TYPO Berlin macht er zunächst einmal nicht Kunst, sondern Werbung – für seine Frau, die ihn auf die Bühne begleitet: Sie habe auf der Art Cologne „einen Förderpreis gewonnen und, ja, auch ein paar Bilder verkauft“. Die beiden arbeiten zusammen, „wenn es um Werbung geht“. Auf der Bühne der TYPO Hall assistiert sie bei der Präsentationsabfolge: erst Werbung, dann Kunst. Schirners Arbeitsauffassung für egal welchen Bereich: „Sie sind der Schöpfer Ihres Bildes in Ihrem Kopf.“ Conclusio: „Mich gibt es gar nicht“ – so der Titel seines Vortrags.
Dieser Auftritt wird zu einem Nebenthema der TYPO und erregt den Unmut vieler Besucher/innen: ein alternder, leicht gebrechlich wirkender Herr (Schirner ist Jahrgang 1941), so verdient sein Werk auch sein mag, lässt sich von seiner schönen (!) jungen (!!) asiatischen (!!!) Frau auf der Bühne assistieren. Sie darf die Folien weiterschalten, während er sich inszeniert: ein offensichtliches Bild und so sehr Klischee, dass es doch kaum Klischee sein kann.
Kaltschnäuzigkeit counts
Darf der das? Darf er es, weil er Michael Schirner ist? Ist es (ihm) egal? Ist es genau deshalb null Inszenierung, sondern Teil seiner Lebenswirklichkeit? Ist eine gewisse Kaltschnäuzigkeit gegenüber dem, was sich geziemt, die beste Voraussetzung für ein gutes Leben – und gute Arbeit? Sind das an dieser Stelle zu viele Fragen?
Weiter im Text. Michael Schirner verweist auf sein Buch „Werbung ist Kunst“, erschienen 1982. Er war 10 Jahre lang Kreativchef der GGK in Düsseldorf. Sein Chef Paul Gredinger formulierte dafür drei Ziele, bzw. skizzierte sie beim gemeinsamen Abendessen auf Schirners Serviette: Er solle „die beste Stimmung“ in der Agentur erreichen, die GGK zur kreativsten Agentur in Deutschland machen, und drittens, als Ergänzung, nicht unbedingt Profit anstreben – sondern ggf. auch mal Kunden rausschmeißen. All das mit dem Ziel, allerbeste Werbung (ist gleich Kunst) zu machen.
Schreibmaschinen und Schnapstrinker
Diese Strategien gab Schirner an seine Teams weiter. Und er ließ es die Kunden wissen. Das heißt, er fragte sie, ob sie „die allertollste Werbung“ machen wollten – und „die meisten wollten mitmachen“. Ergebnisse waren Bilder und Texte, die wegweisend wurden.
Da wäre der legendäre Schriftzug „schreIBMaschinen“ für IBM (eines der Schlüsselerlebnisse in Sachen Text der Autorin, damals circa 14 und sprachlos vor Bewunderung). Aus diesem logoartigen Schriftzug, ja, einer regelrechten Textmarke (keine klassische Wortmarke) entstand eine Kampagne mit Tippfehlern, die auf die Korrekturtaste der SchreIBMaschinen verwiesen. „Liebe Sekrätorin, die IBM XY hat eine Korrekturtaste.“ (Boah. Das wollte ich auch – aber was genau machte der da? Werbung, Kunst, Wahnsinn? Was war das für ein Beruf, „Werber“?)
Ist Schirner Werber, Künstler, Texter? Auf jeden Fall auch ein Texter, ein Vorbild in Sachen Umgang mit Text – man bedenke: Schreibmachinenschrift und getippter Schreibmaschinentext für eine Kampagne, die überhaupt nur auf Text basiert, so klar und auf der Hand liegend wie es nur geht. Schweigeminute, bitte.
Weitere grandiose Aktionen, pardon: Werbemaßnahmen – immer auf der Basis von „Faulheit als Gestaltungsprinzip“ – entstanden unter anderem für Volkswagen und für Jägermeister. Die Fortgeschrittenen im TYPO Publikum erinnern sich an das genial einfache Textkonzept „Ich trinke Jägermeister, weil …“, dazu der Claim „Jägermeister. Einer für alle.“ (Die Protagonisten waren diverse Mitarbeiter von Schirner und Leute von der Straße, die zitierten Texte deren Originalaussagen.)
Text sells
Zwischen Bild und Text entstand bei Schirner immer eine möglichst spannende, nicht immer im allerersten Sekundenbruchteil klare Verbindung. Genau das war (ist) so toll und bleibt in Erinnerung: „Taille 59. Hüfte 88. Creme 21.“
„Wir bleiben mal bei den Körperteilen“, fährt Schirner fort und zeigt unter anderem Anzeigen für Präservative, bzw. für eine AIDS-Aufklärungskampagne, mit dem immer gleichen expliziten Bildmotiv: einem ergierten Penis, auf den eine Männerhand ein Kondom ansetzt. Headline: „Man kommt nicht mehr ohne.“
Die leckersten Plakate ever
Weniger körperlich, mehr kulinarisch-köstlich kommen die Plakate für Pfanni daher: Ein riesiger knusprig-leckerer Kartoffelpuffer springt uns an, nur die Headline wechselt von Motiv zu Motiv. Mein absoluter Headline-Favorit (hier in der Präsentation leider nicht gezeigt): der „Panni Pfuffer“. Unvergesslich.
Die Anzeigenserie wiederum mit der immer gleich lautenden Überschrift „Was man in 8 Minuten am Telefon alles sagen kann. Ihre Post.“ zeigt ganz unterschiedliche, die Doppelseite jeweils füllende Fließtexte, für die man immer etwa acht Minuten Lesezeit braucht. (Das hat sich in der Jetztzeit erstmals wieder die Baumarktkette Hornbach getraut, mit ihren grandiosen und grandios langen Fließtexten auf den Plakaten im letzten Jahr. Leider nachträglich, bei dieser Gelegenheit: Hut ab vor dem Textkollegen oder der Textkollegin, die/der das durchgesetzt hat. Können wir uns bitte kennenlernen?).
„Bald kommt Kunst“, erinnert uns Schirner, „das ist alles noch Werbung“.
Fühlt sich aber gar nicht so an.
Werbung wird Kunst
Für eine Kampagne, die Kunstausstellungen in Düsseldorf bewirbt, lässt Schirner Unterschriften von Künstlern in Öl malen und fügt sie zu einem Anzeigenmotiv zusammen. Diese riesig vergrößerten, gerahmten Bildunterschriften erinnern augenblicklich an das Werk oder zumindest einzelne Bildbeispiele der jeweiligen Künstler. „Wir haben mit Vorliebe auch Werbung für Kultur gemacht“, erzählt Schirner, zum Beispiel für die erste große Ausstellung für moderne Kunst von Kaspar König: 20, 30 Zitate berühmter Künstler auf Plakaten und Postkarten (Beispiel: „Was mich interessiert, ist Geld“ – Salvador Dalí). Diese Kampagne lebt als Postkartenserie bis heute fort und dokumentiere, „was Künstler so denken und sagen“. Zu finden sei sie unter anderem bei „dem Bruder“, in der Buchhandlung König.
Jetzt wird es ganz schön Kunst: „Albert Einstein streckt die Zunge raus“ steht auf einem schwarzen Quadrat in weißer Schrift – und wir alle sehen das Bild. Die Textserie beschreibt Bilder, die in unserem kollektiven Gedächtnis verankert sind, und dokumentiert das Funktionieren von Erinnerung.
In seiner nächsten Serie, einer Reihe Schwarz-Weiß-Fotografien, denkt Schirner dieses Prinzip weiter und zeigt Bilder, in denen die Hauptfigur, der Kern des Motivs jeweils fehlt: zum Beispiel Willy Brandt bei seinem berühmten Kniefall. Wir sehen ihn, obwohl er auf dem Bild fehlt. Er ist da, obwohl er gar nicht da ist.
Obwohl Michael Schirner ermahnt wird, seine Redezeit einzuhalten, und keinen dramaturgisch perfekten Abschlusssatz mehr formulieren kann, ist die Botschaft klar. Und es hätte den Abschlusssatz auch nicht gebraucht. Im Gegenteil: Vielleicht ist es genau richtig, dass kein eigentlicher Abschluss da ist. Die Erkenntnis ist trotzdem da – oder erst recht.
Großen Respekt und vielen Dank, lieber Michael Schirner. Für alles.